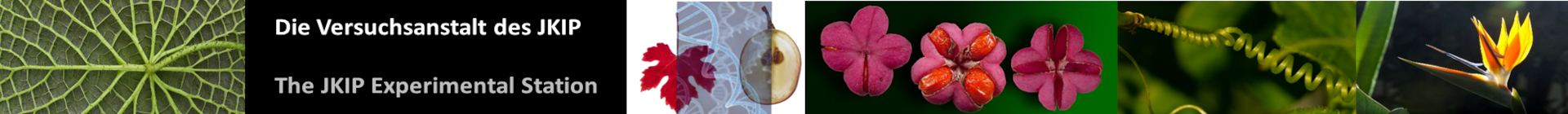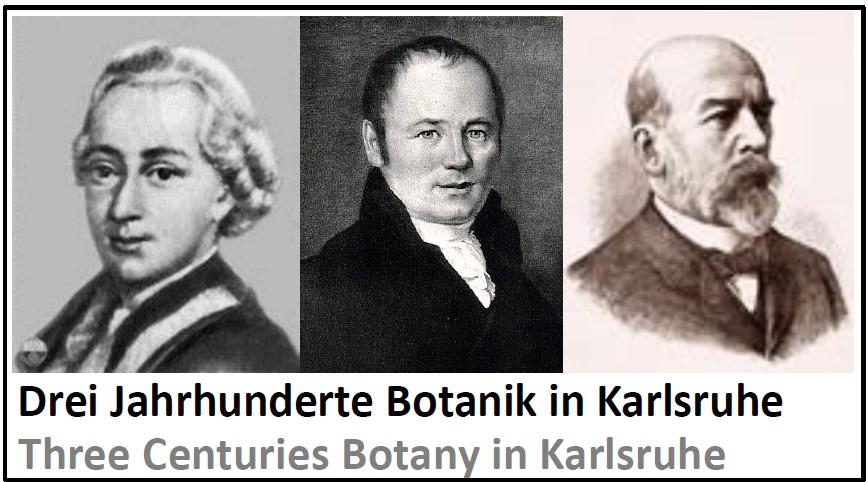Botanik in Karlsruhe - 300 Jahre Wissenschaft und Gesellschaft
↵
|
|
Botanik in Karlsruhe - immer am Puls der ZeitKarlsruhe wird gewöhnlich mit dem Polytechnikum in Verbindung gebracht, das später zur Technischen Universität und schließlich zum KIT wurde. Nur wenige wissen, dass die Geschichte der Pflanzenwissenschaften viel weiter zurückreicht als die der Ingenieurswissenschaften. Die Anfänge sind sogar älter als die Gründung der Stadt. Schon im 17. Jahrhundert begann Markgräfin Sybilla Augusta damit, sich systematisch mit der Nutzung von Pflanzen auseinanderzusetzen und begründete damit eine Familientradition, in der Pflanzen und Botanik eine wichtige Rolle spielten. Die Stadt war noch im Entstehen, als der Botanische Garten zur Wiege von wissenschaftlichen Durchbrüchen wurde. mehr...
KölreuterDer Botaniker ´Joseph Gottlieb Kölreuter wurde nicht nur zum ersten wissenschaftlichen Direktor des Botanischen Gartens ernannt, sondern begann auch im sogenannten Küchengarten mit Experimenten zur Vererbung und legte damit die wissenschaftliche Grundlagen für eine Disziplin, die heute unter der Bezeichnung der Genetik die modern Biologie entscheidend prägt. Sein einfaches, aber bahnbrechendes Kreuzungsexperiment, mit dem er zeigte, dass beide Elternteile symmetrisch zur Vererbung beitragen und nicht nur die Väter, wie man damals allgemein glaubte, ist so wichtig, dass wir es als Demonstrationsversuch nachgestellt haben. Nach vielen vergeblichen Anläufen fand er zwei Arten von Wildtabak, die sich in ihrer Blütenform unterschieden und auch miteinander kreuzbar waren. Damit zeigte er, dass die Nachkommen die Eigenschaften beider Eltern aufwiesen. Dieses Experiment wurde nicht nur von der russischen Zarin Katharina der Großen mit einem Preis ausgezeichnet, sondern markiert auch den Startpunkt von Genetik als Wissenschaft. Ein ganzes Jahrhundert später zog Gregor Mendel aus den Arbeiten Kölreuters (die er detailliert in seinem berühmten Werk zitiert) die Idee, dass die symmetrische Vererbung ja bedeutet, dass alle Merkmale doppelt vorliegen, so dass es sein kann, dass ein Merkmal eines Elternteils durch das Merkmal des anderen Elternteils überdeckt wird. Es wird dann zwar vererbt, bleibt aber zunächst unsichtbar. Er spricht von "nicht sichtbaren Merkmalen".
GmelinDas 19. Jahrhundert begann mit Umbrüchen und Krisen - die Französische Revolution hatte das alte Europa ins Wanken gebracht, die Napoleonischen Kriege löschten ganze Staaten aus und schufen neue. Klimatische Krisen wie das "Jahr ohne Sommer" (1816) kamen hinzu. Carl Christian Gmelin war nicht nur der Direktor des Botanischen Gartens und damit in der Traditionslinie Kölreuters, er war gleichzeitig der Gründungsdirektor des Naturkundemuseums. Er sah die Wissenschaft im Dienste der Gesellschaft und erforschte neue Nutzungsformen von heimischen Pflanzen, um die ökonomische Krise bewältigen zu können. Viele seiner Ideen werden heute unter dem Namen Bioökonomie wieder aufgegriffen und weiterentwickelt. mehr...
BlankenhornDer stürmische Aufschwung Amerikas rüttelte auch in Süddeutschland die Gesellschaft durcheinander. Die Folgen der Globalisierung hatten auch eine botanische Komponente. Neue Pflanzenkrankheiten wurden eingeschleppt und riefen große Krisen und Umbrüche hervor. Die Kartoffelfäule ließ eine Million Iren verhungern und trieb drei Millionen in die Emigration, die Reblaus vernichtete mehr als die Hälfte der Weinberge in Europa und brachte den Weinbau in Baden zeitweise zum Erliegen, auch hier machten sich Hunderttausende Migranten in Richtung USA auf. Auch die gescheiterte Revolution von 1848 trieb Menschen aus dem Land, darunter den badischen Revolutionär Friedrich Hecker, der sich schließlich in den USA niederließ und dort Weinbau betrieb. Er beobachtete, dass die amerikanischen Wildreben immun waren und überzeugte in einem jahrelangen Briefwechsel, Adolph von Blankenhorn, der als Assistent von Leonhard Roesler an der TU Karlsruhe über Weinchemie forschte, die heute übliche Pfropung der Reben auf eine reblausresistente Unterlagssorte, zu erproben und schickte ihm sogar Samen einer Naturhybride, die resistent war. Als Roesler, enttäuscht über die mangelnde Unterstützung der badischen Regierung, nach Klosterneuburg in Österreich wechselte, gründete Blankenhorn ein privates Önologisches Forschungsinstitut, das erste deutsche Weinbauinstitut überhaupt. Die Mission war, den Weinbau auf wissenschaftliche Grundlage zu stellen. Dies war ein Erfolgsmodell - das Pfropfen der Weinreben ist der weltweit wichtigste Fall von biologischer Schädlingsbekämpfung, die Züchtung von PiWi-Reben (für pilzwiderstandsfähig) erlaubt es, den Fungizideinsatz auf einen Bruchteil des Üblichen zu reduzieren, Weinbauinstitute gibt es inzwischen in allen Bundesländern, wo Weinbau betrieben wird und auch die Nachbarländer übernahmen diesen Ansatz, Wissenschaft und Praxis zusammenzubringen. mehr... |