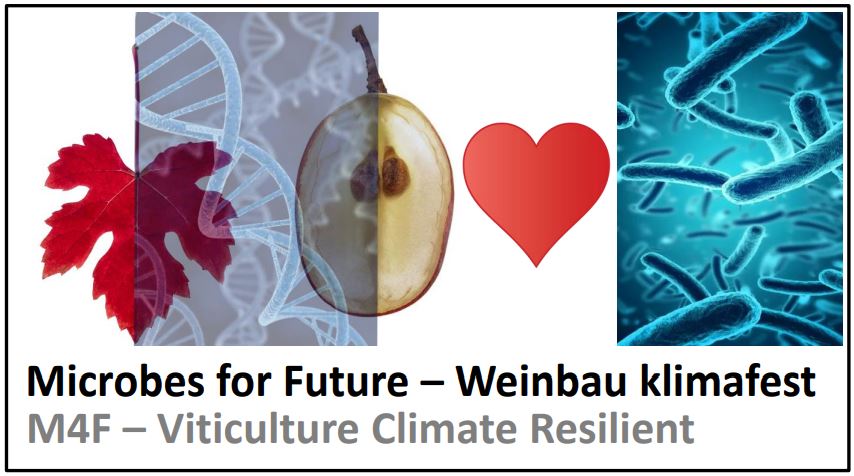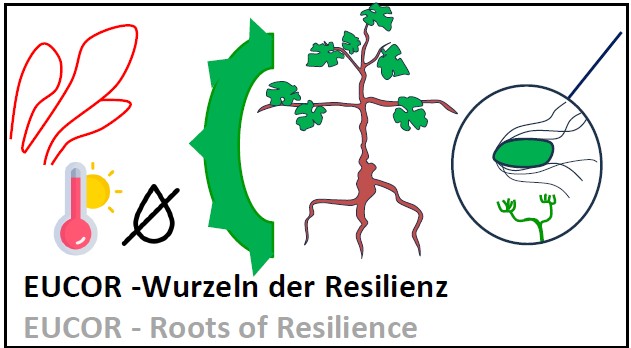 |
M4F News: EUCOR Project Roots of ResilienceEUCOR, the trinational assocation of Upper-Rhine universities (Karlsruhe, Strasbourg, Freiburg, Colmar-Mulhouse, Basel) launched a call for so-called Seed Money projects. Here, partner KIT-JKIP (Islam Khattab, Peter Nick) together with the University of Basel (Pascale Flury) and the Université Haute-Alsace (Julie Chong) was successful with the project Roots of Resilience. The project tries to render grapevine more resilient against climate-change born novel fungal diseases ("Esca & Co") through improved microbial communities in the rhizosphere. The project is based on results of Kliwiresse, but also previous Upper Rhine Interreg projects, especially Vitifutur and DialogProTec. However, the central reason for the success of the proposal was the cooperation cultivated over four Interreg Upper Rhine networks. The Seed Project in turn will feed into the planned sequel project Robin Root. Planned start is February 2025, running time is two years. more... |
|
M4F - Microbes for Future
Der Klimawandel ist auch in unserer Region angekommen. Die heißen und trockenen Sommer hinterlassen auch im Weinbau immer mehr Spuren. An sich harmlose Pilze, die als zumeist friedliche "Mitesser" im Holz des Weinstocks siedeln, werden plötzlich zu üblen Killern, die ihre Wirtspflanze binnen weniger Tage mit Giftstoffen umbringen und dann die Energie der Leiche nutzen, um sich der sexuellen Fortpflanzung hinzugeben und dann über die Sporen sich einen neuen, ertragreicheren Wirt zu suchen. Es handelt sich nicht um eine neue Krankheit. Die erste Beschreibung dieses sogenannten apoplektischen Zusammenbruchs stammt aus dem im frühen Mittelalter herausgegebenen Buch Kitab al Filaha, das damals das gesammelte landwirtschaftliche Wissen der arabischen Welt wiedergab. Freilich ist dieses Phänomen, unter den Winzern auch als Esca-Syndrom bekannt (weil das Holz zunderartig, lateinisch esca, zersetzt wird) immer häufiger geworden. Allein im Elsass werden die 2018 durch Esca verursachten Schäden auf mehr als 1 Mrd. € geschätzt.
In unseren früheren Forschungen konnten wir zeigen, dass die Apoplexie von einer fehlgeleiteten chemischen Kommunikation zwischen dem gestressten Wirt und dem Pilz verursacht wird. Wir konnten ebenfalls zeigen, dass manche Europäischen Wildreben in der Lage sind, diese Kommunikation zu ihren Gunsten zu verändern und so resistent sind. Wenn wir ein Verfahren finden, dies auch in unseren anfälligen Kulturreben hinzubekommen, könnten wir so den Weinbau klimafest machen.
Genau dies ist das Ziel unseres Projekts „Microbes for Future“. So wie wir eine Darmflora haben, die für unser Immunsystem wichtig ist, besitzen Pflanzen in ihrem Wurzelraum ein sorgsam gepflegtes Pflanzenmikrobiom. Wir wollen nun herausfinden, wie sich dieses Mikrobiom von kranken und gesunden Reben unterscheidet und ob wir es günstig beeinflussen können. Dazu wollen wir sogenannte terra preta (Schwarzerde) einsetzen und untersuchen, wie wir dadurch das Mikrobiom und das pflanzlichen Immunsystem verbessern können.
Das Projekt ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen dem Botanischen Institut (Prof. Dr. Peter Nick) und dem Institut für Biologische Grenzflächen V (Prof. Dr. Anne Kaster) und wird aus dem Strategiefond des Präsidiums gefördert.